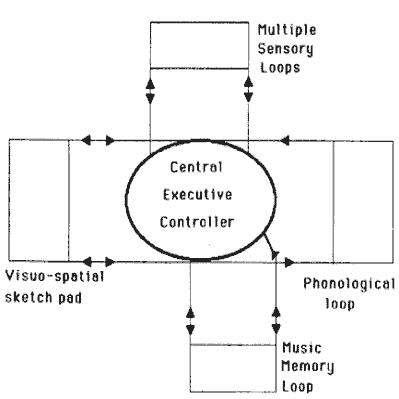|
Peter Matussek Déjà entendu. |
||||
|
|
|||||
|
Schon bei seiner Einführung in die wissenschaftliche Literatur[1] meinte der Begriff Déjà vu anderes als er besagt. Die beiden Primärquellen, auf die sich Ludovic Dugas in seinem terminologisch grundlegenden Artikel von 1894 bezog[2], verwenden bezeichnenderweise auch gar nicht diesen Ausdruck, sondern einen allgemeineren: Dugas zitiert zum einen die von ihm befragte Person A., die ihm den Eindruck schilderte, "que j'avais déjà vécu identiquement l'instant qui venait de s'écouler"; zum anderen Paul Verlaine, dessen Gedicht Kaléidoscope mit den Versen beginnt: "Dans une rue, au cœur d'une ville de rêve,/ Ce sera comme quand on a déjà vécu".[3]Das Phänomen, um das es dem Gedächtnispathologen in Abgrenzung von der "fausse mémoire" ging, ist also nicht etwa durch seine Visualität charakterisiert. Der Begriff Déjà vu ist dementsprechend immer wieder modifiziert worden – unlängst wurde gar vorgeschlagen, ihn ganz fallen zu lassen und je nach Erlebnisgehalt durch Déjà vécu, Déjà senti und Déjà visité zu ersetzen.[4]Auf der anderen Seite erscheint es durchaus sinnvoll, das Déjà vu entgegen der eingebürgerten Konvention für visuelle Eindrücke zu reservieren, um ihm Déjà-Erlebnisse anderer Sinnesmodalität vergleichend gegenüberzustellen. Dies gilt insbesondere für den aus einem solchen Abgrenzungsbedürfnis hervorgegangenen, aber nie systematisch definierten Begriff Déjà entendu. In der Tat ergeben sich aus dieser Vergleichsperspektive aufschlußreiche Phänomendifferenzen. So hat just das zentrale Merkmal des Déjà vu – das Gefühl der subjektiven Vertrautheit im objektiv Unvertrauten – unter auditiven Vorzeichen offenbar ganz andere Begleiterscheinungen: Dem Déjà entendu fehlt in der Regel das Befremdliche oder gar Beängstigende des Déjà vu.[5]Diese Beobachtung notierte bereits John Hughlings-Jackson in einem 1889 veröffentlichten Forschungsbericht. Er zitierte darin einen Patienten, der an Temporallappen-Epilepsie litt und von Déjà-Erlebnissen auditiven Inhalts berichtete: "The recollection is always started by another person's voice, or by my own verbalized thought, or by what I am reading and mentally verbalize; and I […] feel strongly that they resemble what I have felt before under similar abnormal conditions." Obwohl der Patient ahnt, "that the recollection is ficiticious and my state abnormal", kann er sich der Suggestion authentischen Wiedererlebens nicht entziehen. Doch anders als bei einem Déjà vu üblich, verursacht dieser Zustand hier "a slight sense of satisfaction as if it had been sought for"[6], also kein Unbehagen, sondern einen Lustzuwachs. Läßt sich die Differenz der Reaktionsformen mit der unterschiedlichen Sinnesmodalität erklären? Manches spricht dafür. Die Akzeptanz gegenüber 'altered states' ist erfahrungsgemäß bei auditiver Induktion größer als bei visueller – nicht zufällig werden in Tranceritualen bevorzugt akustische Stimuli eingesetzt.[7]So löst denn auch der Eindruck, etwas schon einmal gehört zu haben, ohne daß sich eine Quellenerinnerung einstellt, weniger Befangenheit aus als vielmehr regressive Sehnsüchte. Oliver Sacks etwa beobachtete bei einer Patientin, die aufgrund ihrer Temporallappenschädigung in durchdringender Prägnanz Lieder ihrer Kindheit wiederhörte, "nostalgische Ausschweifungen". Sie beteuerte: "Ich weiß, daß Sie hier sind Doktor Sacks. Ich weiß auch, daß ich eine alte Frau in einem Altersheim bin, die einen Schlaganfall gehabt hat, aber ich fühle mich wieder wie als Kind in Irland. Ich fühle die Arme meiner Mutter, ich sehe sie vor mir, ich höre sie singen".[8]Dieser Nostalgie-Effekt, der sich bis zur affektiven Hinwendung auf unvordenkliche Ursprünge steigern kann, dürfte grundsätzlich damit zusammenhängen, daß das Hören in zeitlicher Ausdehnung stattfindet, während das Sehen der Raumdimension verhaftet bleibt. Da also das Erlebnis der Vertrautheit im Unbekannten beim Déjà vu tendenziell mit beklemmenden Empfindungen der situativen Erstarrung einhergeht, bietet das Déjà entendu eo ipso einen emotional öffnenden Ausweg aus dieser Paradoxie, da Klänge ihrer Natur nach niemals stillstehen, sich äußerlicher Fixierung entziehen. Durch Musik wird, mit Hegel gesprochen, "der innere Sinn, das abstrakte Sichselbstvernehmen" angesprochen; sie bringt "den Sitz der inneren Veränderungen, das Herz und Gemüt […] in Bewegung".[9]E.T.A. Hoffmann nennt sie "die romantischste aller Künste", da ihre ahnungsvolle Sprache, die wir "vergeblich […] in Zeichen festzubannen" suchen, "die Brust des Menschen mit unendlicher Sehnsucht erfülle".[10]Der ironisierende Kontext dieser Formulierungen – Hoffmann legt sie seinem exaltierten Kapellmeister Johannes Kreisler in den Mund – relativiert sie nicht etwa im Sinne einer Zurücknahme, sondern einer Verstärkung, die die pathologischen Tendenzen musikalischer Entrückung hervorhebt. So ist wohl jedem Menschen die Erfahrung geläufig, daß ein Musikstück, das im Zustand der Verliebtheit gehört wurde, diesen Zustand beim Wiederhören nicht nur zurückbringen, sondern an atmosphärischer Intensität übertreffen kann, was im Fall einer nichtkongruenten Realität bisweilen an den Rand des Wahnsinns führt. Das populärste Beispiel hierfür ist der Song As time goes by aus Casablanca, der eine verdrängte Liebesepisode dammbruchartig revoziert: Ricks Geliebte schmilzt beim fahrlässigen Wiederhören("Play it, Sam!") rettungslos dahin; und auch er verliert die Fassung – allerdings nur kurzfristig, da ihm das Drehbuch Affektkontrolle abverlangt. Dezidiert psychotische Qualitäten dagegen verbindet Hector Berlioz mit dem musikalischen Erinnern in seiner Symphonie Fantastique: Die obsessive Wiederkehr des Liebesthemas dokumentiert in ihren vielfältigen Variationen die Stadien eines sich bis zur Verzweiflung steigernden "Trips"[11]; die klangliche Reminiszenz an die Geliebte wird dabei zur "fixen Idee", die der im Opiumrausch phantasierende unglückliche Liebhaber nach Berlioz' programmatischen Erläuterungen "überall wiederfindet, überall hört".[12]Eine lebensgeschichtlich noch tiefere Dimension erinnernden Hörens berührt der Liebeswahn[13] im dritten Akt der Contes d'Hoffmann von Jacques Offenbach: Als Antonia den Klang der Stimme ihrer verstorbenen Mutter "wie früher" zu hören meint, empfindet sie gegenüber diesem "Lied von Liebe" eine "Glut", die sie zugleich "verzückt und verzehrt". In der Tat wird ihre Sehnsucht der Einswerdung mit diesem urspünglichen Klangerleben sie in den Tod treiben. Denn es ist eben nicht einfach ein Wiedererkennen der mütterlichen Stimme, was sie unwiderstehlich anlockt und das Singverbot ihres Vaters und ihres Geliebten Hoffmann übertreten läßt, sondern eine transitorische Hörerfahrung, inszeniert vom teuflischen Dr. Mirakel, die auf unerklärliche Weise an die Urerfahrung von Liebe jenseits der biographisch erfahrenen appelliert. Der Ruf der Mutter ist nur Transmitter von dämonischen, die Grenzen bewußten Andenkens überschreitenden Kräften: "Höre ihre Stimme!/ Ja, deine Mutter ruft dich!/ Meine Stimme ruft dich!"[14]Die Evokation transzendenter Ursprungsgefühle[15] qualifiziert den akustisch induzierten Liebestod Antonias als Déjà entendu: Sie wähnt sich Klängen vertraut, die sie in ihrem Leben noch nicht gehört haben kann. Noch einen Schritt weiter zurück in die Präexistenz geht Das Klagende Lied von Gustav Mahler. In Anlehnung an das Märchen vom erschlagenen Ritter, dessen Gebein, zur Flöte geschnitzt, musikalisch an seine Ermordung erinnert, inszeniert der Komponist das Déjà entendu als akustische Wiedergeburt: Das "seltsam traurig Singen"[16] der Flöte bringt am Königshof zu Gehör, was dort nie gehört wurde und doch sogleich "wieder"-erkannt wird. – Die genannten Beispiele aus der Musikgeschichte beruhen freilich auf ästhetisch-fiktiven Vorstellungen von der Fähigkeit des erinnernden Hörens, über das biographische Gedächtnis hinauszugehen. Doch es gibt durchaus in der philosophischen wie auch der kognitions- und neuropsychologischen Forschung Versuche zur rationalen Erklärung solcher Phänomene. Auf sie soll im folgenden zunächst eingegangen werden (I), um daraus die Kriterien für eine Beschreibung der Wirkungsmechanismen von Déjà-entendu-Erlebnissen zu entnehmen (II).
I. Theorien über die Inhalte erinnernden Hörens
Klangkosmologen wie zuletzt Peter Sloterdijk interpretieren die Wahrnehmung, von einer nie bewußt gehörten und doch seltsam vertrauten Stimme angesprochen zu sein, als "pränatale Auditionen". Der Philosoph beruft sich dabei auf "das phantomhafte Bild von einem flüssigen und auratischen Universum – ganz aus Resonanzen und Schwebstoffen gesponnen", in dem "die Urgeschichte des Seelischen zu suchen" sei.[17]Sloterdijks Klanguniversum besteht also aus mikro-sphärischen Größen, sogenannten "Blasen"; diese präludieren den "Globen", in denen sich später die menschlichen Raumvorstellungen manifestieren – eine Entäußerung, die implizit stets auf ihre "blasenhaften" Urspünge bezogen bleibt.[18]So abstrus derartige metaphysische Unterscheidungen des Auditiven und Visuellen heute anmuten mögen, haben sie doch eine lange philosophiegeschichtliche Tradition. Legt man die entsprechenden Vorstellungen von Reinkarnation und Metempsychose zugrunde, läßt sich sowohl die Anamnesis vorgeburtlicher Erfahrungen wie auch die diesbezügliche Überlegenheit des Hörens über das Sehen erklären, da jenes dem Logos – der stimmlichen Urerfahrung Gottes – näher ist.[19]Was aber bleibt über das erinnernde Hören zu sagen, wenn diese metaphysischen Fundamente ihre Verbindlichkeit verloren haben? Kann es dann immer noch beanspruchen, tiefere Schichten unseres Erinnerungsvermögens zu erreichen? Empirische Forschungen zur Spezifik auditiver Gedächtnis- und Erinnerungsleistungen gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten. Das Hauptaugenmerk der Kognitionspsychologen und Neurowissenschaftler galt bislang der optischen Wahrnehmung bzw. dem visuellen Kortex. So hat es erstaunlich lange gedauert, bis ein simples Experiment zu der bahnbrechenden Erkenntnis führte, daß wir über ein eigenständiges Gedächtnissystem für musikalische Eindrücke verfügen: Diana Deutsch stellte in einem Versuch zum Behalten von Tonhöhen fest, daß eine Note über ein Intervall von fünf Sekunden auch dann gut behalten wurde, wenn sich die Probanden in der Zwischenzeit Zahlen zu merken hatten; war das Intervall hingegen mit anderen Tönen ausgefüllt, sank die Merkleistung beträchtlich.[20]Die fehlende Interferenz zwischen der Kurzzeitspeicherung von Tonhöhen und der von Zahlen bewies also, daß es sich um unabhängig voneinander operierende Gedächtnisarten handelt. Aus diesem und anderen Experimenten folgerte Deutsch: "one must conclude that a specialized system exists for the storage of tonal pitch."[21]Ein entsprechend gegenüber dem klassischen Modell verändertertes Schema des Kurzzeitgedächtnisses hat William Berz postuliert; darin ergänzt ein eigenständiger "Music Memory Loop" die bisher für ausreichend gehaltene phonologische Schleife[22]:
Das Phänomen des erinnernden Hörens ist aber auch damit noch nicht hinlänglich erfaßt. Was wir über die Mechanismen der Wiedererkennung von Tonhöhen, Intervallen oder Melodien wissen, reicht nicht aus, um die damit assoziierten episodischen Erinnerungen zu erklären. Ob etwa das Sirenensignal für "Luftangriff" korrekt identifiziert oder als Reminiszenz früheren Erlebens wahrgenommen wird, ist zweierlei. Die Erforschung des auditiven Gedächtnisses hat sich bisher fast ausschließlich mit dem ersten Aspekt befaßt. Das dürfte nicht zuletzt dadurch bedingt gewesen sein daß sie bis weit in die siebziger Jahre überwiegend vom Militär finanziert wurde[23], das natürlich mehr an den mnemonischen Potentialen von Klängen, etwa bei der Luftraumüberwachung, interessiert ist als an den ekphorierenden[24] – abgetan als Nebenwirkungen. Erklärungsbedürftig ist also nicht so sehr die triviale und seit je bekannte Tatsache, daß sich Informationen besser einprägen, wenn sie nach musikalischen Kriterien wie Rhythmus, Melodie und Gleichklang aufbereitet werden. Wir wissen recht gut, warum Merksprüche von der Art "a, ab ex und de/ cum und sine, pro und prae" oder "Iller, Lech, Isar, Inn/ fließen rechts zur Donau hin"das Auswendiglernen erleichtern. An den präliteralen Kulturen, die mangels schriftlicher Aufzeichnungen einen hohen Bedarf an auditiver Speicherung hatten, ist der Gebrauch musikalischer Merkhilfen inzwischen klar nachgewisen. Seit Milman Parry und sein Schüler Albert B. Lord den alten Verdacht August Wilhelm Schlegels verifizierten, daß die homerischen Epen nach den mnemotechnischen Erfordernissen einer oralen Überlieferung komponiert seien[25], wurde das Wissen um diesen Aspekt auditiven Erinnerns fortlaufend erweitert.[26] Regelmäßig vernachlässigt wurde aber dabei, daß die Griechen neben dem mnemonischen Gebrauch des auditiven Gedächtnisses auch einen ganz anderen kannten, den sie auf Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung und Mutter der Musen, zurückführten. Dieser Traditionsstrang behandelt musikalische Elemente nicht als Merkhilfen, sondern als Anlaß von Erinnerungserfahrungen, die das Subjekt mit seiner Vorvergangenheit in Berührung bringen, wie es schon aus den Musenanrufen bei Homer, Pindar und anderen hervorgeht.[27]Das Zustandekommen solcher Erfahrungen nicht tautologisch, d.h. durch Zugrundelegung der antiken Explikationsmodelle, zu beschreiben, sondern im historisch-anthropologischen Rekurs auf Phänomene, die jene Modelle erst hervorbrachten, ist ein bis heute weitgehend uneingelöstes Desiderat. Um die entsprechenden Erfahrungsformen freizulegen, kann ihre mythologische Einkleidung freilich nicht außer Acht gelassen werden; vielmehr bietet gerade sie einen Zugang. Dies läßt sich insbesondere am Mythos von Orpheus demonstrieren. Schon die ältesten Quellen sahen im Sohn der Muse Kalliope und damit Enkel der Mnemosyne einen Präzedenzfall für die anamnetische Evokationsmacht der Musik. Unter anderem klagt er so bewegend über den Verlust seiner Geliebten, daß ihr Erinnerungsbild lebendig wird: Er kann Eurydike aus dem Hades zurückholen. Dabei darf er sich nicht umblicken – ein zwar erst bei Vergil notierter, aber gewiß ältere Überlieferungen aufgreifender Hinweis darauf, daß die Musik die sichtbare Welt transzendiert. In Ovids Version der Geschichte heißt es explizit, daß Orpheus der Reanimation seiner Geliebten solange sicher sein kann, wie er der Versuchung widersteht, ihrer im Bild habhaft zu werden – "avidus", also "gierig, habsüchtig" ist das Attribut, mit dem Ovid den tabuisierten Blick charakterisiert.[28]Das Erinnerungspotential, das Orpheus von Mnemosyne geerbt hat und musikalisch zur Entfaltung bringt, beruht also nicht auf Mnemotechnik, sondern auf deren Subvertierung. Zwar können wir nichts Genaues über die Qualität jener Musik wissen, der die Griechen jene Wunderkraft zuschrieben. Alle Rekonstruktionsversuche[29] müssen mangels gesicherter Kenntnisse über die Klangcharakteristik der Instrumente und die kulturellen Kontexte ihrer Spielweise sowie dezidierter Notationssysteme spekulativ bleiben. Wir können aber indirekt, aus Beschreibungen und Abbildungen erschließen, welche Wirkungen Orpheus bzw. die realhistorischen Musikdarbietungen, aus denen sich seine Legende nährt[30], auf seine Umgebung ausübten. Dabei ist ein vorherrschendes Bildmotiv die Wirkung des orphischen Gesangs auf Tiere.[31]Es zeigt an, daß es sich um Klänge handelt, die unmittelbar die Instinkte ansprechen. Die Tiere sind, wie Nietzsche es pointiert ausgedrückt hatte, die Meister der Selbstvergessenheit; sie würden diese Fähigkeit auch gerne den Menschen lehren – wenn sie nicht immer gleich vergäßen, was sie sagen wollten. Gerade dadurch aber bewahren sie in ihrem Inneren das Geheimnis eines Lebensglücks, das die Historie negiert.[32] Erinnerungen aktiviert die Orpheus zugeschriebene Musik also just durch das Vergessenmachen der kulturellen Merkzwänge zugunsten eines von ihnen überformten Urerlebens. In genauer Entsprechung hierzu wird Mnemosyne von Hesiods Theogonie charakterisiert, der ältesten Quelle, die den Namen der Erinnerungsgöttin erwähnt: Sie habe, heißt es da, nur scheinbar paradox, die Musen geboren, "damit sie Vergessenheit brächten der Leiden und Ende der Sorgen".[33]Mnemosyne bringt zuallererst Lesmosyne, und ihr genuines Medium ist die Musik, die eigentliche "Musenkunst". Denn Melos, Rhythmus und Klang vermögen besser als alle anderen künstlerischen Ausdrucksformen, die Festschreibungen des biographischen Gedächtnisses aufzulösen und für eine Anamnesis präkognitiver Erfahrungsdimensionen zu öffnen. Orpheus, Sohn der "schönstimmigen" Kalliope, ist hierfür der mythologische Beweis. Die Wirkung seines Gesangs wird immer wieder als hypnotisierend beschrieben. So zum Beispiel, wenn es die streitbaren Argonauten, ohne daß diese wissen, wie ihnen geschieht, friedlich stimmt und schließlich "bezaubert" entschlummern läßt[34], oder wenn es gar – wie in der erwähnten Episode mit Eurydike – die Geister der Unterwelt zu einem ungekannten Erbarmen beim Hören der Klagelaute bewegt. Gerade dieses Motiv kann als mythische Umschreibung für das ek-statische Heraustreten aus den Bedingungen des körperlichen Daseins gedeutet werden, das sich nach Dodds aus dem schamanistischen Seelenritt herleitet: "Wie die Schamanen überall, unternimmt [Orpheus] eine Wanderung in die Unterwelt, und sein Motiv dabei ist unter Schamanen sehr verbreitet: er will eine geraubte Seele zurückholen".[35]Auch von Mircea Eliade wird Orpheus zum "Großen Schamanen" ernannt.[36] In markanter Opposition hierzu steht jene Gedächtniskunst, die dem griechischen Lyriker Simonides gemeinhin zugeschrieben wird. Just dem angeblichen Erfinder der Mnemotechnik aber verdanken wir das erste Dokument, das Orpheus' Namen erwähnt. Darin wird dieser als ein Musiker charakterisiert, der nicht nur Menschen, sondern die gesamte Natur in seinen Bann zog, selbstvergessen in buchstäblicher Hörigkeit:
Ihm auch in endloser Zahl
Das Fragment handelt von einer musikalisch evozierten Resonanz zwischen Mensch und Natur; es hintergeht damit den Gedächtnishorizont der visuellen Fixierung von Memorabilia, deren Lobpreis die römische Rhetorik in legitimatorischer Absicht Simonides andichtete – was diese, weniger ihn charakterisiert.[38] Erinnerungsaktivierung durch Klänge, nicht Gedächtnisspeicherung durch Bilder war es, womit Simonides seinerzeit Ruhm erlangte.[39]Beliebt waren insbesondere seine Threnoi, die er so anrührend vorzutragen vermochte, daß die Toten wieder lebendig zu werden schienen. Auch jener Palastkatastrophe, die ihn angeblich auf die Erfindung der Ars Memoria gebracht hat, dürfte er vielmehr einen seiner Trauergesänge gewidmet haben, und zwar mutmaßlich den folgenden Threnos auf die ihm befreundete Skopadenfamilie, der den atopischen Grundzug seiner Gedenkkunst unterstreicht:
Sei, der du Mensch bist, nie der Meinung,
Nicht das Lob der topographischen Merkmethode – das angesichts jener grausam fixierten Sitzordnung schierer Zynismus wäre – spricht aus diesen Versen, sondern das Eingedenken der Flüchtigkeit des Daseins. Vom wandelbaren Geschick ist hier die Rede, das im Herzen zu bewegen statt an Gedächtnis-loci zu befestigen sei. Damit benennt der Lyriker unabhängig von allen Resurrektionsmythen ein Merkmal des erinnernden Hörens, das auch für die musiktheoretische Behandlung des Themas im Zentrum steht. Gemäß der These von Curt Sachs etwa, daß die Anfänge der Musik auf einer Frühform des Melos, sogenannten "tumbling strains", beruhen, die bei Naturvölkern in der Form von langgezogenen Schreien vorkommen[41], mag man annehmen, daß die antiken Klagegesänge die Eigenschaft hatten, an solche archaischen Laute zu erinnern, und daraus ihre Dissoziationseffekte ableiten. Die Urspungsfrage muß freilich im Dunklen bleiben. Auch Beobachtungen bei den sogenannten Naturvölkern werden von Musikethnologen und -psychologen durchaus unterschiedlich interpretiert. Während Gilbert Rouget die Funktion der Musik bei schamanistischen Ritualen lediglich darin sieht, ein akustisch kommuniziertes "Bild" der angenommenen Identität aufrechtzuerhalten[42], glauben andere an primär physiologische Ursachen musikalisch induzierter Trance – z.B. "hypnotische Suggestion" durch "ohrenbetäubendes Getöse"[43], Pawlowsche "bedingte Reflexe" auf ankonditionierte musikalische Stimuli[44] oder rhythmische "driving"-Effekte, die das Alltagsbewußtsein subvertieren.[45]Mythische Überlieferung und mediale Praxis sind offenbar gleichermaßen daran beteiligt, daß Schamanen sich in Trance versetzen können, um mit ihrer derart vom Körper gelösten Seele zu höheren Mächten oder den Geistern der Verstorbenen zu reisen bzw. entführte Seelen heimzuholen. Läßt man allerdings die unterschiedlichen Kontexte beiseite, in denen solche Tranceerfahrungen jeweils kulturspezifisch plausibilisiert werden, bleibt gleichwohl ein erstaunlich konstantes Grundmuster übrig.[46]Stets handelt es sich um einen akustisch induzierten Regreß auf ein Vergangenheitserleben, das die Grenzen des biographischen Erinnerns überschreitet. Die Déjà-vu-Forschung steht bezüglich solcher Phänomene vor dem Dilemma, sie entweder metaphysisch – durch Wiedergeburt, Archetypen[47] oder morphogenetische Resonanz[48] – zu erklären oder sie als Bekanntheitstäuschung – hervorgerufen etwa durch eine neurologische Potentialverschiebung vom Frontalhirn auf die Temporallappen[49] – abzutun. Beim Déjà entendu liegen die Dinge anders, da auditive Erinnerungen tatsächlich auf pränatale Gedächtnisspuren zurückgehen können. Im Unterschied zur visuellen Wahrnehmung, die sich erst nach der Geburt entwickelt, werden Höreindrücke bereits während der Schwangerschaft aufgenommen und vorbewußt gespeichert. Ein Blick auf den Forschungsstand hierzu lohnt sich, denn er trägt dazu bei, die Spezifik von Déjà-entendu-Erlebnissen zu charakterisieren. Auch wenn seit 1670 bekannt ist, daß das Innenohr bereits nach der Hälfte der Schwangerschaftszeit seine endgültige Größe erreicht hat[50], erfolgte der Nachweis, daß akustische Eindrücke mit diesem früh entwickelten Organ auch tatsächlich wahrgenommen werden, erst sehr viel später: Die Veranlassung von motorischen Reaktionen bei Föten durch Klanginduktion wird seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts systematisch untersucht.[51]Fortschritte der Tontechnik wurden dazu genutzt, diesen Befund weiter zu spezifizieren – insbesondere hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Hertz- und Herzfrequenz.[52]Dank digitaler Aufzeichnungsverfahren ist die intrauterine Geräuschwelt mittlerweile zum öffentlichen Konzertpodium geworden.[53]Doch was davon erinnerbar ist, läßt sich sehr viel schwerer bestimmen. Studien aus den sechziger und frühen siebziger Jahren sprechen noch vorsichtig von einer "possibility that the maternal heartbeat is an imprinting stimulus".[54]In den letzten zwei Jahrzehnten aber konnte eine Fülle von Belegen dafür zusammengetragen werden, daß die Höreindrücke der Föten insgesamt engrammatische Bedeutung haben. In einer Versuchsreihe etwa lasen Frauen während der letzten sechs Wochen ihrer Schwangerschaft laut eine bestimmte Geschichte. Ihre Babies zeigten später durch ihr Saugverhalten, daß sie lieber die ihnen "bekannte" Geschichte hörten als eine andere.[55]Selbstverständlich haben diese Wiedererkennungsreaktionen nichts mit dem Inhalt des Vorgelesenen zu tun. Vielmehr ist es die spezifische Klangcharakteristik der intrauterin vernommenen Laute, die später als vertraut wahrgenommen wird. Dies gilt nicht nur für die unmittelbar präsente Tonumgebung der Mutter; offenbar ist das auditive Gedächtnis der Föten bereits derart differenziert, daß es verschiedene menschliche Stimmlagen – aber auch Lieder oder Titelmelodien von Fernsehserien – auseinanderhalten kann. Dies beweisen unterschiedliche Reaktionen von Babies auf entsprechende Orchestrierungen.[56] Nimmt man diese Befunde als Beleg für das Vorhandensein eines vorbewußten Klanggedächtnisses, so bietet sich eine Erklärung für Déjà-entendu-Erlebnisse an, die weder auf metaphysische Spekulationen noch auf Bekanntheitstäuschungen rekurrieren muß: Die Betroffenen können aufgrund pränatal engrammierter Hörerinnerungen bei bestimmten Klängen das durchaus stimmige Gefühl der Vertrautheit haben und zugleich wissen, daß sie diese Klänge "noch nie", d.h. soweit sie zurückdenken können, vernahmen. Eine solche Erfahrung schildert etwa der Dirigent Boris Brott: "Die Musik war schon vor meiner Geburt ein Teil von mir […] Als junger Mann war ich verblüfft über meine ungewöhnliche Fähigkeit, manche Stücke ohne Noten zu spielen. Da dirigierte ich eine Partitur zum ersten Mal, und plötzlich sprang mir die Cello-Stimmführung ins Gesicht, und ich wußte, wie das Stück weitergeht, bevor ich das Blatt umgedreht hatte." Brott fand zu einer Erklärung, die vor dem Hintergrund der erwähnten Forschungen einleuchtet: "Eines Tages erwähnte ich das meiner Mutter gegenüber, einer Berufscellistin. Ich dachte, es würde sie verwundern, weil es ja immer die Cello-Stimme war, die mir so klar vor Augen stand. Aber als sie hörte, um welche Stücke es sich handelte, löste sich das Rätsel von selbst. Alle Partituren, die ich ohne Noten kannte, waren diejenigen, die sie gespielt hatte, als sie mit mir schwanger war."[57]Die seltsamen Protentionen erwiesen sich also als Retentionen aus intrauteriner Nacht. Zur Stützung dieser Erklärungshypothese für Déjà-entendu-Erlebnisse trägt die jüngere Neurowissenschaft durch ihre Forschungen über das implizite Gedächtnis bei. Zwar hatte schon Freud auf das Vorhandensein von Erinnerungen spekuliert, die dem Bewußtsein nicht zugänglich sind und gleichwohl das menschliche Verhalten beeinflussen, doch erst seit Beginn der achtziger Jahre gibt es systematische experimentelle Nachweise hierzu – etwa durch Versuchsanordnungen zum sogenannten "Priming"[58] oder zur posthypnotischen Quellamnesie.[59]Déjà-Erlebnisse sind demzufolge auf den impliziten "Einfluß eines Erfahrungssplitters" zurückzuführen, "der durch die gegenwärtige Situation aktiviert wird, aber nicht explizit abgerufen werden kann."[60]Im speziellen Falle des Déjà entendu wäre diese Abrufsperre nicht auf biographische Ereignisse beschränkt, was ihren spezifischen Sehnsuchtscharakter erklären könnte: Tonale Reminiszenzen an die "pränatale Koenästhesie"[61] der Mutter-Kind-Symbiose haben zweifellos einen stärker nostalgischen Charakter als die unerklärliche Wiederkehr von Situationen, die mit dem Getrenntheits-Zustand der Individuation assoziiert werden. Daß die Erinnerungsquelle bei Déjà-Erlebnissen "im Dunklen" bleibt, wäre demnach im Fall des Déjà entendu als ontologische, nicht nur metaphorische Aussage zu rechtfertigen. Der Klangtherapeut Alfred Tomatis allerdings ist davon überzeugt, daß die primären Hörerfahrungen durch spezielle Verfahren der auditiven Stimulation wiedergewonnen werden können. Er verwendet hierzu "gefilterte" Klänge, die der Fruchtwasser-Akustik des Mutterleibs entsprechen und so jenes vorbewußt-tonale Körpergedächtnis aktivieren sollen, das sich während der Schwangerschaft bereits vollständig innerviert hat: "Die längst versunkenen, in das älteste Entwicklungsstadium des Menschen zurückreichenden Erlebnisse, wieder wachgerufen mit Hilfe der gefilterten Töne, führen rasch zur Begegnung mit dieser Dimension."[62]Das auditive "Eintauchen in memoriam" steht Tomatis zufolge jedem Menschen offen, wird aber in der Regel verhindert durch den Informationsdruck des Alltagsgedächtnisses: Das Überangebot an Klangreizen führt zu einer sensorischen "Verstopfung"; diese und die Dominanz des Intellekts verdrängen das ursprüngliche Hörerlebnis. Tomatis folgert, "daß das Gedächtnis paradoxerweise die Erinnerung zu behindern scheint".[63]Wie schon in den Überlieferungen von Mnemosyne und Orpheus wird hier die Dissoziation des Alltagsgedächtnisses zur Bedingung für die Anamnesis vorbewußter Urlaute gemacht. Tomatis spricht diesbezüglich von einem "Déjà-connu" und erklärt es als Reaktivierung pränataler Engramme.[64] Einwände gegen solche Spekulationen können sich insbesondere auf die mittlerweile gründlich erforschte Tatsache stützen, daß episodische Erinnerungen in einem erheblichen Ausmaß auf Konstruktionen beruhen. Schon Bartlett hatte den experimentellen Nachweis geführt, daß "condensation, elaboration and invention are common features of ordinary remembering".[65] Dieses inventive Moment wird heute unter dem Begriff der Konfabulation gefaßt, die fiktionalen Ergänzungsleistungen benennend, die – spontan und von den Betroffenen in der Regel unbemerkt – je nach aktueller Stimmung und Lebenssituation in das Bild der eigenen Vergangenheit einfließen.[66]Daß solche supplementären Phantasmen mit der Lückenhaftigkeit der biographischen Erinnerungen zunehmen, ist naheliegend.[67] Indessen ist der konstruktive Charakter episodischer Erinnerungen noch kein Indiz, das gegen die Herleitung von Déjà-entendu-Erlebnissen aus präkulturellen Klangwahrnehmungen spricht. Er beweist lediglich, daß es zur Erklärung nicht genügt, jene "nostalgischen Ausschweifungen", mit denen solche Erlebnisse oft einhergehen, allein auf tatsächlich vernommene Höreindrücke zurückzuführen. Das Gefühl der Kopräsenz von Gegenwart und Vergangenheit wird gerade dann sehnsüchtige Formen der Selbstsuche hervorrufen, wenn das Subjekt die Chance erhält, seine Lebensgeschichte wunschgemäß zu konfabulieren. Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Osternacht-Szene aus Goethes Faust: Die durch den Stubengelehrten erfolgreich verdrängte Atmosphäre von "Glockenklang und Chorgesang" erweckt im Moment des Entschlusses zum Selbstmord unversehens "Ein unbegreiflich holdes Sehnen"; die auditive Erinnerung hält ihn "mit kindlichem Gefühle/ Vom letzten, ernsten Schritt zurück" (V. 775–784). Was hier dem Sich-Erinnernden neue Bodenhaftung verleiht, ist die Reaktivierung eines kulturell überlieferten Erbes – mithin gerade dasjenige, was nach Ansicht von Tomatis die auditive Primärerfahrung verstellt. Nicht der Regreß auf Urlaute, sondern just eine Hörgewohnheit – deren Reminiszenz freilich hinlänglich unbestimmt sein muß, um eine phantasieorientierte Rekonstruktion der eigenen Vergangenheit zu ermöglichen – evoziert die berühmteste Nostalgieträne der Weltliteratur. In der nüchternen Sprache der Kognitionspsychologie handelt es sich hierbei um einen "stimmungskongruenten Abruf", bei dem die momentane Klangwahrnehmung mit einer früheren interagiert.[68] Nicht einfach die Wiederkehr der vergangenen Klangeindrücke also, sondern vielmehr ihre Vagheit und Ferne ist es, die erst im unerwarteten Zusammentreffen mit den Konfabulationsbedürfnissen der gegenwärtigen Rezeptionssituation den spezifischen Charakter des erinnernden Hörens auszeichnet. Eben dieses konstruktive Moment offenbart die Unzulänglichkeit einer Erklärung von Déjà-entendu-Erlebnissen im Sinne der auch unter Musikwissenschaftlern populären[69] Tomatis-Hypothese. Das Wiederhören – wie weit es auch immer zurückreichen mag – könnte nicht die von dem Klangtherapeuten intendierte Evokationskraft haben, wenn es sich um eine bloße Reidentifizierung handelte. Es muß mit dem Gefühl eines Mangels verbunden sein, um die transgressive Dynamik einer "akustischen Geburt" zu erreichen. Das kulturelle Gedächtnis in seiner das auditive Primärerleben überlagernden Funktion kann eben deshalb genauso Katalysator wie Antagonist des erinnernden Hörens sein. Allerdings ist es denkbar, daß jene Mangelerfahrung auch schon während der Schwangerschaft auftritt. Der Fötus vernimmt schließlich nicht nur den Klang der mütterlichen Stimme, sondern auch deren Ausbleiben. Suzanne Maiello zufolge vermittelt dieser akustische Wechsel dem Ungeborenen eine "Proto-Erfahrung von Anwesenheit und Abwesenheit". Die Autorin schließt aus der zeitlichen Koinzidenz zwischen der Ausbildung des Gehörs und der ab dem fünften Schwangerschaftsmonat beobachtbaren Tatsache, daß der Fötus den Daumen in den Mund nimmt, auf einen Zusammenhang zwischen dem "Verstummen der mütterlichen Stimme […] und dem Versuch, diese Lücke durch den Daumen im Mund zu füllen".[70]Mit der Rückverlegung rudimentärer Trennungsempfindungen in den Mutterleib relativiert sich das gängige Bild von pränataler Einheit versus postnataler Gespaltenheit und damit auch einer entsprechenden Differenzierung auditiver und visueller Erinnerungen. Was damit jedoch nicht relativiert wird, ist die Feststellung, daß das Hören wesentlich früher einsetzt und ein intimeres Erleben des Wechsels von An- und Abwesenheit beinhaltet als das Sehen, das sich erst im Stadium der Getrenntheit von der Mutter entwickelt, also von vornherein auf jenen Distanzerfahrungen beruht, aus denen die Psychonalyse das Gefühl einer "räumlichen Befangenheit" und die selbstentfremdende "Quadratur der Ich-Prüfungen" ableitet.[71]Sollte also das Déjà-entendu-Erlebnis auf fötale Höreindrücke zurückzuführen sein, setzt es sich ebenso aus tonalen Ab- wie Anwesenheitseindrücken zusammen; und gerade die letzteren sind, wie wir gesehen haben, für seine evokatorische Wirkung entscheidend. Erinnerndes Hören, so läßt sich das bisher Gesagte resümieren, erschöpft sich nicht im bloßen Wiedererkennen tonaler Reize, sondern beruht auf einer Aktivität des Hörers, der das tatsächlich oder scheinbar Vertraute aus Versatzstücken der momentanen Lebenssituation und Gefühlslage zu produzieren. Der Sonderfall des Déjà entendu ist dabei durch die Unmöglichkeit gekennzeichnet, den Eindruck der Kopräsenz gegenwärtiger und vergangener Hörerlebnisse auf eine bewußte Quellenerinnerung zurückzuführen. Da für das Auftreten derartiger Phänomene die Rückführbarkeit auf tatsächliche Klangereignisse geradezu kontraproduktiv ist, reicht die biographische Perspektive, die uns auf die fötalen Höreindrücke und das implizite Gedächtnis brachte, für eine Erklärung nicht aus. Vielmehr müssen wir nach der Art der akustischen Stimuli fragen, die in der beschriebenen Weise ekphorierend wirken. Lassen diese sich unabhängig von subjektiven Rezeptionsvoraussetzungen spezifizieren oder gar gezielt einsetzen? Anhaltspunkte hierfür gibt es in der Tat – ja die Evokation von Déjà-entendu-Erlebnissen ist geradezu ein konstitutives Merkmal von Musik.
II. Musikalische Anlässe erinnernden Hörens
Rhythmen, Melodien oder Modulationen können wir als solche nur wahrnehmen, wenn wir vergangene Klänge im Gedächtnis präsent halten und sie mit den neu hinzukommenden zu entsprechenden musikalischen Einheiten synthetisieren. Eine Grundbedingung des Musikhörens ist also die Wiederkehr. Damit disponiert sie a priori für das Déjà entendu – in den Worten von George Rochberg: "Return in music has something of the force of the past suddenly illuminating the felt present as a real element in the present."[72]Dieses generelle Statement ist freilich in der gleichen Weise zu differenzieren wie wir es oben hinsichtlich der Unterscheidung von mnemonischen und anamnetischen Memorialformen getan haben: Musikalische Figuren wie Echo, Imitation, Reprise, Zitat und Parodie appellieren primär an ein Wiedererkennen im Sinne sensomotorischer Routinen; sie fallen, mit Bergson gesprochen, in den Bereich der reconnaissance automatique. Um das erinnernde Hören im oben bezeichneten Sinne anzusprechen bedarf es Figuren der Widerkehr, die Selbstaufmerksamkeit hervorrufen – Bergsons reconnaissance attentive.[73]Diese kommt im Bereich der Musik überall da zustande, wo das Erinnerungserleben mit der persönlichen Situation des Hörers in Verbindung gebracht wird. Eine entscheidende Voraussetzung hierfür haben wir bereits kennengelernt: Die Erinnerungen müssen hinlänglich unbestimmt sein, um Ergänzungsleistungen des Rezipienten hervorzurufen, die ihm das Gefühl geben, mit seiner Vergangenheit in Berührung zu kommen. Musik erfüllt diese Bedingung genau dann, wenn die Figuren der Wiederkehr sich einer unmittelbaren Re-Identifizierung entziehen, so daß in den Erinnerungsprozeß zwangsläufig supplementäre Konstruktionsleistungen des Hörers einfließen. Das einfachste Beispiel hierfür ist die Variation, die auf Bekanntes anspielt, ohne es zu kopieren. Um ein musikalisches Thema aus seiner variierten Form "herauszuhören", muß die eigene Erinnerung nach verwandten Klangeindrücken abgesucht werden; das Subjekt wird damit in eine Haltung der Selbstinvestigation versetzt. Dieser Effekt verstärkt sich in dem Maße, wie der Bekanntheitscharakter verfremdet wird. Die erwähnte "idée fixe" bei Berlioz und die von ihr vorbereitete Leitmotivik Wagners haben entsprechende Wirkungen; mehr noch die Technik der Allusion – z.B. in Schumanns Fantasia op. 17, das auf Beethovens Lied an die ferne Geliebte anspielt, ohne daß die Forscher je herausgefunden haben, worin diese Anspielung besteht[74], oder in Brahms' Liederreihe op. 47, die die persönliche Erfahrung des Liebesverzichts durch ein Konnotationsnetz motivischer Verweise, die stets unterhalb der Wiedererkennbarkeitsschwelle bleiben, als Sehnsuchtsdynamik zum Ausdruck bringt.[75]In der Moderne wird die Tendenz zur Subversion von Hörgewohnheiten zunehmend gesteigert. Franz Schrekers Oper Der ferne Klang etwa schickt seinen Protagonisten, den Komponisten Fritz, auf die Suche nach einem "Sehnsuchtston", der nie wirklich zu hören ist, sich aber durch das Motiv der "Nähe seiner Geliebten" andeutet.[76]Dieses Déjà entendu wird durch einen spektakulären Kontrasteffekt für das Auditorium nachvollziehbar gemacht: Nachdem das gewaltige Orchester den Hörer an seinen impressionistischen Klangreichtum gewöhnt hat, setzt es plötzlich aus und läßt nur leisen "Harfenklang" (wiederum nur angedeutet von einer Celesta) übrig – ein wirkungsvolles Mittel zur Durchbrechung auditiver Habituation, die für das "Unerhörte" aufmerksam macht. Mit melodischen Reminiszenzen, die dem Hörer zwar vertraut, aber in ihrem musikalischen Kontext gleichwohl nur zu erahnen sind, operiert Alban Berg in seinem Violinkonzert Dem Andenken eines Engels, das in seiner Zwölftonreihung die unerwartete Harmonik einer "Kärtner Weise" und eines Bachchorals aufruft, so daß der auratische Effekt einer Ferne in der Nähe entsteht. Eine radikale Absage an die Konventionen des musikalischen Gedächtnisses schließlich komponiert John Cage mit seiner Musik der Indetermination (Music of Changes) und des Schweigens (4'33''). Der "Klebstoff der Tonbeziehungen"[77] wird hier aufgelöst zugunsten der Freisetzung eines "latenten, selektiv aktualisierten Möglichkeitsraumes"[78] – verstanden als Erinnerung im emphatischen Sinne, die konsumistische Hörgewohnheiten transzendiert. Entgegen ihrem avantgardistischen Selbstverständnis sind diese Tendenzen keineswegs neu. Wie erwähnt, wurde schon der orphische Gesang als Anamnesis eines Urklangs beschrieben, der durch das Vergessenmachen des Alltagsgedächtnisses vernehmbar wird. Die Musikgeschichte hat dieses Motiv mit den je zeitgenössischen Mitteln zu reproduzieren gesucht. So steht jede Opernreform im Zeichen Orpheus' – Adorno vertrat gar die These, "alle Oper sei Orpheus".[79]Und schon Monteverdi, der Begründer dieser Tradition, inszeniert mit seinem Orfeo die Evokationsmacht der Musik als Durchbrechung von Hörgewohnheiten: Zunächst läßt er Orpheus einen nach zeitgenössischer Geschmackskonvention schönen Gesang, einen "bel canto"[80], anstimmen. Darin kommt die Korrespondenz zum natürlichen Urlaut durch Echoeffekte, also eine der unmittelbarsten Formen musikalischer Wiedererkennung, zum Ausdruck.[81]Die musikdramatische Pointe bei Monteverdi ist aber, daß sich die erhoffte Resonanz-Wirkung nicht einstellt: Charon, der Fährmann zur Unterwelt, bleibt völlig unbeeindruckt. Erst als Orpheus sich und seinen Zuhörer vergißt[82], findet er den revokatorischen Ton, der Charon hypnotisiert und den Erinnerungsweg zu Eurydike öffnet.[83]Monteverdi will mit diesem Kontrastverfahren nicht nur eine mythische Erzählung plausibilisieren, sondern zugleich dem Opernpublikum ein Modell für die Rezeption seiner Musik geben: Es soll nicht reidentifizierend, sondern selbst affektiv erinnernd hören. Rezeptionsformen wie die hier beschriebene verbinden sich durch die gesamte Musikgeschichte hindurch mit dem Orpheus-Mythos. Dieser wird bis in die neuesten Spielarten elektronischer Musik, insbesondere der Trance-Techno-Szene[84], als programmatische Orientierung für die Evokation erinnernden Hörens aufgegriffen. Um die ungebrochene Aktualität der entsprechenden Wirkungsintentionen besser zu verstehen und kulturgeschichtlich einordnen zu können, seien zunächst zwei literarische Beschreibungen erinnernden Hörens vorangestellt, die den modernen und postmodernen Blick auf das Phänomen repräsentieren. In beiden Fällen handelt es sich um fiktive Musikstücke, die aber an realen Vorbildern orientiert sind: die Musik Vinteuils, die in Prousts Suche nach der verlorenen Zeit Momente der mémoire involontaire veranlaßt, sowie das Orgelspiel in Robert Schneiders Roman Schlafes Bruder, in dem der Protagonist das Auditorium hypnotisiert durch seine anamnetische Choralimprovisation. So sind Prousts Vinteuil-Episoden, wie George Painter herausgearbeitet hat, maßgeblich von César Franck inspiriert.[85]Dessen Klavierquintett f-moll war ein thematischer Vorgriff auf die sieben Jahre später komponierte Violinsonate. Der Roman dreht dieses Verhältnis allerdings um. Die Recherche beschreibt zunächst das Hören einer Violinsonate, um diese dann in einer späteren Passage als Reminiszenz in einem Quintett aufscheinen zu lassen. Den primären Höreindruck schildert der Erzähler als indeterminiert:
Vielmehr blieb mir die Sonate auch noch dann, als ich sie von Anfang bis zu Ende angehört hatte, als Ganzes unsichtbar wie ein Bauwerk, von dem man wegen des Nebels oder der großen Entfernung nur einzelne Partien undeutlich wahrnehmen kann. […] Als die Sonate von Vinteuil mir ihr verborgenstes Inneres entdeckte, begann, von der Gewohnheit schon aus dem Bereich meiner Empfänglichkeit entrückt, was ich zuerst daran mit Bewußtsein gleichsam bevorzugt festgestellt hatte, mir bereits zu entschwinden, zu entfliehen. Da ich nur nach und nach hatte lieben können, was diese Sonate mir brachte, besaß ich sie niemals ganz: darin glich sie dem Leben.[86]
Charakteristisch für den Höreindruck der Sonate ist also die flüchtige, sich der fixierenden Einprägung entziehende Wahrnehmung. Eben diese disponiert den Erzähler beim späteren Hören des Quintetts zu einer um so intensiveren Wiedererinnerung der früher nur undeutlich aufgenommenen Lautgestalten:
Wie wenn in einer Landschaft, die man nicht zu kennen meint, in die man aber tatsächlich nur von einer anderen Seite her gelangt ist, sich plötzlich nach einer weiteren Biegung des Weges ein neuer auftut, dessen geringste Einzelheiten einem vertraut erscheinen und den man nur nicht gewohnt war von dort aus zu betreten, […] so bemerkte ich, wie ich mich plötzlich inmitten dieser für mich neuen Musik in der Sonate von Vinteuil befand; wunderbarer aber noch als eine Fee trat die kleine Weise mir entgegen, von Silber wie von einem lichten Panzer eingehüllt, um und um von blitzenden, leichten schleierzarten Klängen überrieselt und dennoch wiederzuerkennen unter ihrem neuen Glanz. […] Ein Sang durchbrach schon die Luft, ein Sang aus sieben Tönen, so denkbar unbekannt, so weitab von allem entfernt, was ich mir vorgestellt hatte, unaussagbar und gellend zugleich, nicht mehr wie jenes Taubengurren,das die Sonate durchzog, sondern die Luft zerreißend mit der Heftigkeit seiner roten Tönung, […] ein ganz unbeschreiblicher, überscharfer Appell, der aus ewiger Frühe kam. Die kühle, mit Regen getränkte, elektrische Atmosphäre – mit so ganz anderen Eigenschaften begabt, unter ganz anderem Druck entstanden, in einer Welt, die fern von der jungfräulichen und mit pflanzlichem Wachstum erfüllten der Sonate gelegen war – wechselte unaufhörlich und löschte das purpurne Versprechen der Morgenröte wieder aus. Am Mittag jedoch, in einer glühenden, kurzen Sonnenfülle schien sie sich in einem schweren, dörflichen, beinahe bäuerlichen Glück zu vollenden, in dem das Schwingen entfesselt hallender Glocken (ähnlich dem, das flammengleich den Kirchplatz von Combray erfüllt und das Vinteuil, der es sicherlich oft gehört, vielleicht in diesem Augenblick in seinem Gedächtnis gefunden hatte wie eine Farbe, die man auf der Palette unmittelbar vor sich hat) zu intensivster Freude sich zu verstofflichen schien.[87]
Hier findet Marcel, rückprojiziert auf die Erfahrungswelt des Komponisten, zu seiner eigenen Kindheitserinnerung. Gerade die Andersartigkeit der ekphorierenden Klangstimuli läßt das früher Gehörte prägnanter hervortreten als es je wahrgenommen wurde. Was sich einst an unbestimmten Erwartungen und Sehnsüchten an die Sonate knüpfte, entfaltet sich erst in der nachträglichen Wiedererinnerung zur ganzen Fülle des Vergangenheitserlebnisses, das er nun erst imstande ist zu deuten. Eine ähnliche Resurrektion verschütteter Anteile der eigenen Lebensgeschichte, die den Horizont des Biographischen transzendiert, erfährt der Organist Elias am Ende von Robert Schneiders Roman. Aufgefordert, den Bach-Choral Kömm, o Tod du Schlafes Bruder zu improvisieren, spielt er sich in eine Ekstase hinein, die seine verstörte Kindheit und vergebliche Liebessehnsucht in ungekannter Leuchtkraft auferstehen läßt; denn er findet, gleich Orpheus, den Urklang der Natur: Die Natur wurde Musik. Jene geheimnisvollen Novembertage, wo der Nebel vom Rheintalischen auf und nieder schwappte, in den Weiler Hof, wo seine Heimat war. Wie der Nebel in den Wäldern gefror, eisige Fäden von den Zweigen zog und die Rinde der Tannen mit Rauhreif beschlug. Wie sich Mond und Sonne gegenüberstanden – der Mond, eine zerbrochene Hostie, die Sonne, die Wange der Mutter ... Der Schein des ersten Feuers wurde Musik. […] Die Tiere des Waldes im Jännerschnee. Wie er in unhörbaren Lauten, Geräuschen und Trillern nach ihnen rief.[88]
In seiner Musik findet Elias schließlich zum Verschmelzungserlebnis mit der Geliebten, das ihm realiter verwehrt blieb – ebenfalls analog zu Orpheus: Und Elsbeth wurde Musik. Elsbeth! Die Farbe und der Geruch ihres laubgelben Haares, der kaum merkliche Gehfehler, das Lachen ihrer dunklen Stimme, die runden, so lebendigen Augen, das Knollennäschen, das blaue Kleid mit dem großen Karomuster. Wie Elsbeth behutsam durchs Gras schritt, auf daß sie kein Gänseblümchen zertrete. Wie sie mit kleinen Händen die Schnorre einer Kuh streichelte. Zwiesprache mit ihr hielt, heimlich den Säuen Apfelrinden zuwarf ... Während er diese Gedanken in die anrührendste Musik setzte, die jemals gehört worden war, vernahm er auf einmal Elsbeths Herzschlagen wieder. Und er wurde unruhig, der Rhythmus könnte verlorengehen. Aber der Rhythmus blieb und verschmolz mit dem seines eigenen Herzens.[89]
Nach seiner Choralimprovisation, heißt es, hat der Organist auch alle seine Zuhörer auf die "Frequenz seines Herzschlagens" und damit "unter Hypnose gebracht".[90]Schneiders Verdienst ist es, diesen Vorgang nicht einfach im Sinne des romantischen Topos zu literarisieren[91], sondern ihn zugleich durch eine postmoderne Erklärung zu plausibilisieren: Er führt die Wirkungsintensität der Klänge auf Leerräume zurück, die sich zwischen den Tönen auftun. So wird der Beginn des Orgelspiels durch wilde Läufe chrakterisiert, die immer wieder jäh Halt machen: Der Lauf endete in einer schmerzverrissenen Harmonisierung der beiden ersten Takte des Chorals, dann würgte der Organist die Musik derart unmotiviert ab, als seien ihm die Hände plötzlich vom Manual gerutscht. Elias atmete die unerhört spannungsgeladene Zäsur, griff siebenstimmig in die Tasten, spielte den Choral bis zum 3. Takt, riß ab, atmete, harmonisierte in unaufgelösten Dissonanzen bis zum 4. Takt, riß ab, atmete, verband das figurale Kopfmotiv mit der Harmonisierung des Chorals, riß ab, atmete, riß ab, atmete, und das alles über die Dauer von mehr als fünf Minuten. Dergestalt wollte er darlegen, wie man sich gegen den Tod aufzulehnen habe, gegen das Schicksal, ja gegen Gott. Der Tod als jähes Schweigen, als unerträgliche Pause.[92]
Unverkennbar zitiert Schneider damit zwar einen Topos der musikrhetorischen Tradition. Dieser Topos aber wird derart dekonstruiert, daß sich seine didaktische Bedeutung umkehrt: Nicht gottergeben passives Eingedenken der Endlichkeit des Daseins, sondern Auflehnung, eine Eigenaktivität des Hörers also, wird hier durch die musikalischen Zäsuren evoziert. Der Roman bezieht damit auf musikalische Phänomene, was Wolfgang Iser im Bereich der Literatur als "Leerstellen" bezeichnet hat: Lücken im Sinngefüge, die als "Appellstrukturen" für die Imagination des Lesers fungieren.[93]Nachdem dieses Konzept in der neueren Kunstgeschichte und Filmtheorie eine äußerst fruchtbare nachholende Rezeption gefunden hat[94], scheint es mir an der Zeit, dies ebenso für die Musiktheorie zu leisten.[95]Auf die unterschiedlichen Formen auditiver Leerstellen – vox omissa, Suspiratio, Generalpause, Zäsur, Suspension usw. bis hin zum Rauschen oder Schweigen – kann hier nicht näher eingegangen werden.[96]Als deren gemeinsamer Grundzug sei lediglich hervorgehoben, daß es sich um Einschnitte in habituelle Hörmuster handelt, die aufgrund des Kontrasteffekts zwischen Protention und Retention eine gesteigerte Aufmerksamkeit auf den Vorgang des Hörens selbst bewirken. Die immanente Spannung zwischen der Wiedererkennungsfunktion musikalischer Strukturen (die nach Morton Feldman geradezu ihr Wesen ausmacht[97]) und deren Subversion kommt bei aller Verschiedenheit der historischen Stile immer wieder durch dasselbe Grundmuster zustande: Ein entweder vom Stück selbst oder musikgeschichtlich vorgegebener Klangeindruck wird aufgegriffen und zugleich dergestalt der Erwartung der Hörgewohnheit entzogen, daß die Erinnerung an das Frühere vertraut und unbekannt ineins erscheint. Eben das verbindet jede ambitionierte Klangästhetik mit dem Déjà-entendu-Effekt musikalischer Reminiszenz. Nun liegt freilich der Verdacht nahe, daß sich dieses musikalische Phänomen im Zeitalter des digitalen Soundrecycling historisch überlebt habe. Doch ein näherer Blick auf jene Musikrichtungen, die mit repetitiven Strukturen und Samples operieren – wie etwa Techno und Hip Hop – zeigt, daß auch hier der (schon bei Palestrina feststellbare[98]) Ehrgeiz der Produzenten darauf ausgerichtet ist, Wiedererkennbarkeit zu verunmöglichen und so eine Atmosphäre der unidentifizierbaren Reminiszenz hervorzurufen. Wolfgang Voigt etwa erzeugt in seinem Projekt Königsforst aus vielfach "geloopten" Wagner- und Debussyfragmenten ein technologisches Waldesrauschen, das sich wie eine nostalgische Klage über den Verlust einer Trancefähigkeit ausnimmt, die im Prozeß der abendländischen Musikgeschichte immer wieder vermittelt auflebt, aber letztlich unerfüllte Sehnsucht bleibt und nur in der befremdlichen Vagheit von déjà entendu-Erlebnissen erinnert werden kann. Und wer im Hip Hop etwas auf sich hält, sorgt dafür, daß die verwendeten Samples sich jeder Wiedererkennnbarkeit entziehen.[99]So findet sich etwa auf der CD Moment of Truth von Gang Starr ein aggressives Statement gegen Plattenfirmen, die aus Werbezwecken die Namen ihrer gesampelten Bands preisgeben. Auch das aktuelle Soundrecycling also operiert mit den klassischen Mitteln auditiver Erinnerungsaktivierung. "Entscheidend beim Musikhören ist doch schließlich immer die Frage: Woher kenne ich das jetzt nochmal?" resümiert Diedrich Diederichsen in einem einschlägigen Artikel.[100] Gerade an der Offenheit der Antwort auf diese Frage bemißt sich das evokatorische Potential des erinnernden Hörens. Es verliert sich im Wiederfinden.
[1]Die Prioritätenfrage ist freilich ungeklärt; ich beziehe mich diesbezüglich auf German E. Berrios. "Déjà vu in France during the 19th century: A conceptual history." Comprehensive Psychiatry 36 (1995): S. 123–129, hier S. 126. [2]Ludovic Dugas. "Observations sur la Fausse Mémoire." Revue Philosophique 37 (1894): S. 34–45, hier S. 35. [3]André Gide (Hg.). Anthologie de la Poésie Française. Paris, 1949. S. 631. [4]Arthur Funkhouser. "Three types of déjà vu." Scientific and Medical Network Review 57 (1995): S. 20–22. [5]Zu diesen Begleitzuständen des Déjà vu vgl. die Patientenberichte in J. Bancaud/ F. Brunet-Bourgin/ P. Chauvel/ E. Halgren. "Anatomical origin of 'déjà vu' and vivid 'memories' in human temporal lobe epilepsy." Brain 117 (1994): S. 71–90. [6]John Hughlings-Jackson. "On a particular variety of epilepsy ('Intellectual Aura'), one case with symptoms of organic brain disease." Brain 11 (1889): S. 179–207, hier S. 202. [7]Vgl. Peter Matussek. "Berauschende Geräusche. Akustische Trancetechniken im Medienwechsel." Rauschen. Seine Phänomenologie zwischen Sinn und Störung. Hg. Andreas Hiepko/ Katja Stopka. Würzburg, 2001. S. 225–240. [8]Oliver Sacks. "Erinnerung." Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte. Reinbek bei Hamburg, 1995. S. 179–202, hier S. 182 u. 186. [9]Georg Wilhelm Friedrich Hegel. "Vorlesungen über die Ästhetik III." Werke in zwanzig Bänden. Frankfurt am Main, 1995. Bd. 15, S.152. [10]E.T.A. Hoffmann. "Kreisleriana." Fantasie- und Nachtstücke. Nachwort von Walter Müller-Seidel. Anmerkungen von Wolfgang Krohn. München, 1960. S. 39 u. 326. [11]Leonard Bernstein. "Berlioz Takes a Trip." Berlioz: Symphonie Fantastique. New York: Sony Classical, 1999. [12]Zit. nach Wolfgang Dömling. Berlioz. Symphonie fantastique.2. Aufl. München, 1988. S. 77. [13]Vgl. Heather Hadlock. Mad Love. Women and Music in Offenbach's 'Les Contes d'Hoffmann'. Princeton, 2000. [14]Dritter Akt, Trio – Finale. [15]Vgl. hierzu auch Nanny Drechsler. "Stimme/Mutter/Tod – zur Figur der Antonia in Jacques Offenbachs Oper 'Hoffmanns Erzählungen'." Frauenstimmen, Frauenrollen in der Oper und Frauen-Selbstzeugnisse. Hg. Gabriele Busch-Salmen/ Eva Rieger. Herbolzheim, 2000. S. 262–274. [16]2. Satz (Der Spielmann). [17]Peter Sloterdijk. Sphären I. Blasen. Frankfurt am Main, 1998. S. 102. [18]Peter Sloterdijk. Sphären II. Globen. Frankfurt am Main, 1999. [19]Vgl. hierzu den Beitrag von Jens Mattern im vorliegenden Band. [20]Diana Deutsch. "Tones and numbers: Specificity of interference in short-term memory." Science 168 (1970): S. 1604–1605. – Vgl. dies. "Memory and Attention in Music." Music and the Brain. Studies in the Neurology of Music. Hg. Macdonald Critchley/ R.A. Henderson. London, 1977. S. 95–131. – Das Experiment habe ich nachgestellt unter www.sfb-performativ.de/EaGT/ (Erinnerndes Hören, 1). [21]Diana Deutsch. "The organization of short-term memory for a single acoustic attribute." Short-term memory. Hg. Diana Deutsch/ J.A. Deutsch. New York, 1975. S. 113. [22]William L. Berz. "Working Memory in Music: A Theoretical Model." Music Perception 12 (1995), no. 3: S. 353–364, hier S. 362. [23]Vgl. Alan D. Baddeley Die Psychologie des Gedächtnisses. Stuttgart, 1979. S. 291. [24]Ich verwende den Ausdruck Ekphorie in Anlehnung an seinen Schöpfer Richard Semon, der sie als "Aktivierung einer Erregungsdisposition, die als bleibende, aber für gewöhnlich latente Veränderung im Organismus zurückgeblieben ist", beschrieb, wobei nicht die Wiederkehr desselben Reizkomplexes entscheidend ist, sondern lediglich die "Wiederkehr der inneren energetischen Situation". Richard Semon. Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Geschehens (1904). 3. Aufl. Leipzig 1911. S. 170, 176, 181. – Zur Aktualität Semons für die Gedächtniswissenschaft vgl. Daniel L. Schacter. Forgotten Ideas, Neglected Pioneers: Richard Semon and the Story of Memory. Brighton, 2001. [25]Milman Parry. The Making of Homeric Verse. Oxford, 1971. – Albert B. Lord. The Singer of Tales. München, 1965. [26]Vgl. insbesondere Eric A. Havelock. Preface to Plato. Cambridge/ London, 1963. – Jack Goody (Hg.). Literacy in Traditional Societies. Cambridge, 1968. – Walter J. Ong. The Presence of the Word. New Haven/ London, 1967. [27]Vgl. Peter Matussek. "Mnemosyne." Gedächtnis und Erinnerung. Hg. Nicolas Pethes/ Jens Ruchatz. Reinbek bei Hamburg, 2001. S. 378–379. [28]Met. X, 56. [29]Vgl. die Beispiele unter www.sfb-performativ.de/EaGT/ (Erinnerndes Hören, 3). [30]Z.B. berichtet Plutarch, daß Terpander, der Begründer der spartanischen Musikerziehung und Kitharode wie Orpheus, einmal gerufen worden sei, um Aufruhr unter den Lakedaimoniern mit seiner Musik zu schlichten. De musica. § 42. [31]Vgl. Max Wegner. "Orpheus." Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 10. Hg. Friedrich Blume. Kassel u.a., 1962. Sp. 410-412. – John Block Friedman. Orpheus in the Middle Ages. Cambridge (Mass.), 1970. [32]Friedrich Nietzsche. "Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben." Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe.Hg. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. München/ Berlin/ New York, 1988. Bd. 1, S. 243–334, hier: S. 248. [33]Theog. 54f. [34]Apollonius Rhodius. Argonautika. I, 514 ff. [35]Eric Robertson Dodds. Die Griechen und das Irrationale. Darmstadt, 1970. S. 82. [36]Mircea Eliade. Schamanismus und archaische Ekstasetechnik. Frankfurt am Main, 1975. S. 372. [37]Simonides/ Bakchylides. Gedichte. Hg. Oskar Werner. München, 1969. Fr. 31. [38]Vgl. Stefan Goldmann. "Statt Totenklage Gedächtnis. Zur Erfindung der Mnemotechnik durch Simonides von Keos." Poetica 21 (1989): S. 43–66. [39]Freilich wurde er auch von den Griechen schon für sein großes Gedächtnis gerühmt: Gedichte (wie Anm. 37). Fr. 60. Doch worauf diese genau beruhte, bleibt unklar – Gerüchten zufolge sollen auch Drogen im Spiel gewesen sein: Vgl. Herwig Blum. Die antike Mnemotechnik.Hildesheim/ New York, 1969. S. 142. [40]Gedichte (wie Anm. 37). Fr 20. [41]Curt Sachs. The Wellsprings of Music. New York, 1962. [42]Gilbert Rouget. Music and Trance. A Theory of the Relations between Music and Possession. Chicago/ London, 1985. [43]Henri A. Junod. The life of a South African tribe. Neufchatel, 1913. Bd. 2, S. 441–445, hier S. 443. [44]Melville J. Herskovits. Pesquisas ethnologicas na Bahia.Estado, 1943, S. 25. [45]Andrew Neher. Paranormal and Transcendental Experience. A Psychological Examination. 2nd. ed. New York, 1990. [46]Vgl. Eliade. Schamanismus (wie Anm. 36). S. 1–11. [47]C.G. Jung selbst erklärt in diesem Sinne "ein intensivstes 'sentiment du déjà vu'" während einer Zugfahrt durch Afrika: Erinnerungen, Träume, Gedanken, von C.G. Jung, aufgezeichnet und herausgegeben von Aniela Jaffé.Zürich, 1961. S. 258. [48]Rupert Sheldrake. Das schöpferische Universum. 4. Aufl. München, 1992. [49]Vgl. I. Gloning/ K. Gloning/ H. Hoff. "Die Störung von Zeit und Raum in der Hirnpathologie." Wiener Zeitschrift für Nervenheilkunde und deren Grenzgebiete 10 (1955): S. 346–377, hier S. 374. – W. Penfield/ P. Perot. "The brain's record of visual and auditory experience: a final summary and discussion." Brain 86 (1963): S. 595–696. [50]Vgl. T. H. Bast. "Ossification of otic capsule in human fetus." Contrib. Embryol. 121, 21 (1930): S. 53–82. [51]H. S. Forbes/ H. B. Forbes. "Fetal sense reaction: Hearing." Journal Comp. Psychology 7 (1927): S. 353–355. [52] J. Bernard/ L. W. Sontag. "Fetal reactivity to tonal stimulation: a preliminary report." Journal Genet. Psychology 70 (1947): S. 205–210. – K. P. Murphy/ C. H. Smyth. "Responses of fetus to auditory stimulation." Lancet 1 (1962), S. 972–973. [53]Eine Internet-Recherche nach "Womb Sounds" oder "Womb Songs" etwa listet hunderte von Web-Sites. [54]David Walker/ James Grimwade/ Carl Wood. "Intrauterine noise: A component of the fetal environment." American Journal of Obstetrics and Gynecology 109, 1 (1971): S. 91–95, hier S. 95. [55]Anthony J. DeCasper/ W. P. Fifer. "Of human bonding: Newborns prefer their mother's voices." Science 208 (1980): S. 1174–1176. – Anthony J. DeCasper/ A. J. Spence. "Prenatal maternal speech influences newborn's perception of speech sounds." Infant Behavior and Development 9 (1986), S. 133–150. [56]Ein Filmbeispiel zu einem Experiment der University of South California, bei dem ein unruhiges Baby, das durch ein ihm vertrautes Lied des Vaters beruhigt wird, befindet sich unter www.sfb-performativ.de/EaGT/ (Erinnerndes Hören, 7). [57]Zit. nach Ludwig Janus. Wie die Seele entsteht. Unser psychisches Leben vor und nach der Geburt. Heidelberg, 1997. S. 211. [58]Dabei legte man den Vp Wortlisten vor und forderte sie auf, jedes der Wörter fünf Sekunden lang zu betrachten. Selbst eine Woche später noch supllierten die Vp in Wortergänzungsaufgaben fehlende Buchstaben im Sinne der früher vorgelegten Wörter, obwohl diese der bewußten Erinnerung vollständig entfallen waren. Vgl. E. Tulving/ D. L. Schacter/ H. Stark. "Priming effects in word-fragment completion are independent of recognition memory." Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 8 (1982): S. 336–342. [59]Vp erhalten die Instruktion, das unter Hypnose gelernte Material zu vergessen. Im posthypnotischen Zustand kommen ihnen diese Inhalte dann seltsam vertraut vor, ohne sich erklären zu können, warum. Vgl. Hans Christoph Kossak. Lehrbuch der Hypnose. Weinheim und Basel, 1993. S. 286ff. [60]Daniel L. Schacter. Wir sind Erinnerung. Gedächtnis und Persönlichkeit. Reinbek bei Hamburg, 1999. S. 281. [61]Béla Grunberger. Narziß und Anubis. München, 1988. Bd. 2, S. 179. [62]Alfred A. Tomatis. Der Klang des Lebens. Vorgeburtliche Kommunikation – die Anfänge der seelischen Entwicklung. Reinbek bei Hamburg, 1990. S. 213. [63]Ich übersetze die Stelle abweichend von der deutschen Ausgabe (Anm. 62), da das Original (La nuit uterine. Paris, 1981) die beiden Memorialaspekte eindeutig in diesem, oben erläuterten, Sinne unterscheidet.. [64]Tomatis. Der Klang (wie Anm. 62). S. 206. [65]Frederic Charles Bartlett. Remembering: a Study in Experimental Social Psychology (1932). 2. rev. ed. Cambridge, 1995. S. 205. [66]Morris Moscovitch. "Confabulation." Memory distortion: How minds, brains, and societies reconstruct the past. Hg. Daniel L. Schacter et al. Cambridge (Mass.), 1995. S. 226–254. [67]Ira E. Hyman/ F. James Billings. "Individual differences and the creation of false childhood memories." Memory 6 (1998): S. 1–20. [68]Gordon H. Bower. "How might emotions affect learning?" The Handbook of Emotion and Memory: Research and Theory. Hg. S.-Å. Christianson. Hillsdale, N.J., 1992. [69]Vgl. Petra Maria Meyer. Gedächtniskultur des Hörens. Medientransformation von Beckett über Cage bis Mayröcker. Düsseldorf und Bonn, 1977. S. 86ff. [70]Suzanne Maiello. "Das Klangobjekt. Über den pränatalen Ursprung auditiver Gedächtnisspuren." Psyche 53, H. 2 (1999): S. 137–157. [71]Jacques Lacan. "Das Spiegelstadium als Bildner der Ich–Funktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint." Schriften I. Olten, 1973. S. 61–70, hier S. 66f. [72]George Rochberg. "Duration in Music." The Aesthetics of survival: a composer's view of twentieth-century music. Ann Arbor, 1984. Zit. nach Bryn Harrison. "The Auditive Memory and its function in the late works of Morton Feldman." newmusic – Online: www.hud.ac.uk/schools/music+humanities/music/newmusic/auditive_memory.html (8.4.2001). [73]Henri Bergson. Materie und Gedächtnis. Eine Abhandlung über die Beziehung zwischen Körper und Geist (1896). Hamburg, 1991. S. 184f. [74]Dieses Beispiel verdanke ich Tamara Levit. Zur Forschungslage vgl. Berthold Hockner. "Schumann and Romantic Distance." Journal of the American Musicological Society 50, no.1 (Spring 1997): S. 55–132. [75]Vgl. Matthias Schmidt. "Volkslied und Allusionstechnik bei Brahms." Die Musikforschung 54, 1 (2001). [76]13. Szene. Für diesen und weitere Hinweise danke ich Sebastian Handke. [77]Heinz-Klaus Metzger. Zit. nach Mathias Fuchs. "Total recall – Erinnern und Vergessen in der Musik." Kunstforum 127 (1994): S. 170–175. [78]Stefan Schädler. "Die Paradoxie des Gedächtnisses im Werk von John Cage." John Cage. Anarchic Harmony.Hg. ders./ Walter Zimmermann. Mainz, London u.a., 1992. S. 81–96, hier S. 93. [79]Theodor W. Adorno. "Bürgerliche Oper." Gesammelte Schriften. Bd. 16. Frankfurt am Main, 1978. S. 24–39, hier S. 31. [80]3. Akt, La Speranza. [81]3. Akt, Possente spirto. [82]Vgl. zu dieser These auch Klaus Theweleit. Buch der Könige. Bd. 1: Orpheus und Eurydike. Frankfurt am Main, 1995, S. 570. [83]3. Akt, Ahi, sventurato amante. [84]Als Beispiele seien nur genannt: Engines of Orpheus von EtherGun, Orpheus Synthony No. 2 von Neil Duddridge, Orpheus Express von Japanic, Descent of Orpheus von Above the Garage, Orpheus von Umbah und Orpheus von CreamClub2200. [85]George D. Painter. Marcel Proust. Eine Biographie. Frankfurt am Main, 1980. Bd. 2, S. 388ff. [86]Marcel Proust. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Frankfurt am Main, 1979. S. 699. [87]Proust. Auf der Suche (wie Anm. 86). S. 3084–3086. [88]Robert Schneider. Schlafes Bruder. 23. Aufl. Stuttgart, 2000. S. 176f. [89]Schneider. Schlafes Bruder (wie Anm. 88). S. 177. [90]Schneider. Schlafes Bruder (wie Anm. 88). S. 178. [91]Zur Problematisierung dieser geläufigen Zuordnung vgl. Jürgen Barkhoff. "Robert Schneider's 'Schlafes Bruder' – a neo-romantic music novel?" Music and Literature. Hg. Siobhan Donovan/ Robin Elliott. Woodbridge, New York, 2002. [92]Schneider. Schlafes Bruder (wie Anm. 88). S. 173f. [93]Wolfgang Iser. Die Appellstruktur der Texte; Der Lesevorgang; Die Wirklichkeit der Fiktion. Elemente eines funktionsgeschichtlichen Textmodells. Konstanz, 1971. – Ders. Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. München, 1976. [94]Vgl. Wolfgang Kemp. "Verständlichkeit und Spannung. Über Leerstellen in der Malerei des 19. Jahrhunderts." Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. Hg.ders. Berlin/ Hamburg, 1992. S. 307–333. – Gottfried Boehm. "Sehen. Hermeneutische Reflexionen." Kritik des Sehens. Hg. Ralf Konersmann. Stuttgart, 1997. S. 272–299, hier S. 292f. – Edward Branigan. Narrative Comprehension and Film. New York, 1998. S. 15f u. 223. [95]Einen ersten Ansatz hierfür habe ich – im Sinne einer exemplarischen Spezifikation literaler, piktoraler und tonaler Leerstellen – veröffentlicht unter dem Titel "Die Gedächtniskunst und das Gedächtnis der Kunst." Paragrana. Internationale Zeitschrift für historische Anthropologie 9, H. 2 (2000): S. 191-214. – Dabei gibt es hinsichtlich der tonalen Leerstellen Berührungspunkte mit dem Konzept musikalischer "Nullstellen" in Thomas Macho. "Die Kunst der Pause. Eine musikontologische Meditation." Paragrana 2, H. 1–2 (1993): S. 104–115, hier S. 106. [96]Vgl. die Beispiele unter www.sfb-performativ.de/EaGT/Er_Figuren/Seiten/index.html. [97]Morton Feldman "Crippled Symmetry." Essays. Hg. Walter Zimmermann. Kerpen, 1985. Zit. nach Harrison. The Auditive Memory (wie Anm. 72). [98]Heribert Klein. "Tonmaler, im Innern wund. Die Musik folgt dem Wort: Zum vierhundertsten Todestag von Giovanni Pierluigi da Palestrina." Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.1.1994. S. 24. [99]Vgl. Peer Steinwald. "'My Pop Used To Say It Reminded Him Of Bebop.' Erinnerung im Hip Hop". Seminararbeit. Berlin, 2001. Online: www.culture.hu-berlin.de/PM/Leh/StudProj/Steinwald/HIPBOP1.HTM. [100]Diedrich Diederichsen. "Zur musikalischen Technik in Hip Hop und Techno." Vortrag, gehalten am 13.6.1997 in Berlin. Online: www.art-bag.net/contd/issue2/dd.htm. |
|||||